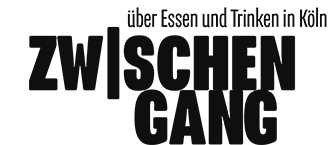Schwarze Köche in deutschen Küchen
von Beni Tonka
Pat
Der Topf knallt auf den Boden. Bang! Bevor er weiterrollen kann, geht Pat dazwischen und bewahrt Deshi vor einem möglichen Kinnhaken des Küchenchefs. Dessen Arm bleibt in der Luft stehen. Pat starrt ihn an, als könnte er ihn mit seinem wütenden, direkten Blick dazu zwingen, herunterzusinken. Ein Showdown in der Küche. Vielleicht wird er sein Job verlieren, vielleicht auch sein Leben. Egal. Niemand sollte jemals wieder in dieser Küche einen Spüler derart behandeln.
Wir standen alle unter Druck. Aber er hatte nur einen Topf fallen lassen. Das zeigt doch, wie man mit Leuten wie uns umgeht.
Der leblose Arm des Chefs sinkt nieder. Er hebt seine andere Hand – diesmal ganz vorsichtig – und zeigt in Richtung Büro. Pat, noch immer vor Deshi, warte darauf, dass er vorangeht. Die Türe schlägt hinter ihnen zu, während der Chef ihn anbrüllt, er habe ihn vor dem Team blamiert.
Mit 14 habe ich in meiner Heimatstadt ein Praktikum in einem Hotelrestaurant gemacht. Eine Woche war ich in der Küche mit dem Chefkoch, einem Rassisten alter Schule. Alle anderen waren nett. Das Team, die jungen Köche – die haben von Grund auf gut gekocht. Sie waren offen und hatten viel Geduld mit mir. Sie haben mich dazu motiviert, Koch zu werden. Eines Tages beim Personalessen fing der Küchenchef aus dem Nichts an, die Spüler anzuschreien – ein Vater-Sohn-Team aus Bangladesh. Er nannte sie Sklavenarbeiter und Schweine, weil sie mit den Händen aßen, wie das ja die meisten Menschen auf der Welt machen. Das sollte man eigentlich wissen, wenn man Küchenchef ist. Aber sein Rassismus stand immer im Vordergrund. Niemand sagte was. Auch ich nicht. Daran muss ich bis heute denken. Das war das letzte Mal, dass ich mich nicht gegen Diskriminierung gewehrt habe. Es ist meine Pflicht, den Mund aufzumachen, weil ich das damals eben nicht getan habe.

Während Pats Ausbildung im Sternerestaurant arbeitet Deshi ohne zu klagen – er ist immer als Erster da, er ist immer der Letzte der geht.
Sie haben ihn wie Scheiße behandelt, ihn angebrüllt, ihm rassistische Spitznahmen gegeben, seine Intelligenz beleidigt. Ironischerweise war Deshi der Einzige, der jemals eine Uni von innen gesehen hatte. Immer wenn sie etwas von ihm wollten – wenn er noch früher kommen oder länger bleiben sollte – dann wurde ich vorgeschickt. Nach dem Motto: “Ihr seid doch beide braun, ihr versteht euch doch.“ Ich war der Einzige, der ihn wie ein Mensch behandelte.
Pat und Deshi sind keine Freunde, aber sie sind beide „die Anderen“ in der Küche. Anders normal. Ein Normal, welches auf Respekt und Mitgefühl basiert und natürlich auf ihrer Zugehörigkeit zu einer sogenannten ethnischen Minderheit.
Wenn ich den Zug zurück in die Stadt verpasst hatte, habe ich bei ihm übernachtet. In der heruntergekommenen Unterkunft ganz in der Nähe.
Aber Deshi hat ein Geheimnis. In ihm wächst etwas, das seine Beine von den Knien abwärts anschwellen ließ. Er versteckte es so gut er kann. Ins Krankenhaus? Vergiss es! Als Asylsuchender wird er schwarz bezahlt. Wenn die Behörden mitbekommen würden, dass er arbeitete, würde er nicht nur seinen Job verlieren, sondern auch nach Bangladesh zurückgeschickt. Darum arbeitet er weiter und wehrte sich nicht gegen den Inhaber, den Chefkoch und das Küchenteam. Aber nach sechs Monaten an der Spüle, 13 bis 14 Stunden pro Schicht, bricht er zusammen. Sein Körper nimmt ihm die Entscheidung ab. Auf einer Liege wird er direkt in die Notaufnahme gebracht, wo seine Beine behandelt werden. Eine Woche später ist er zurück in der Küche, auf seinem alten Posten.
Ich weiß nicht, was danach mit ihm passiert ist.
Weil ihm das tägliche Pendeln zu viel wird, mietete Pat eine kleine Wohnung in der Nähe des Restaurants. Eines Abends, nach der Arbeit, besucht er die örtliche Kneipe, um abzuschalten. Als er eintritt, sein Ausbildungsheft in der Hand, herrscht plötzlich Schweigen.
Alle haben mich angestarrt.
Die Asche fällt von ihren Zigaretten, löst sich in der Luft und rieselt auf den Fliesenboden. Pat lässt sich nicht beeindrucken, nickt und grüßt und begegnet all den kalten Blicke, die ihm zu seinem Tisch folgen. Er nimmt Platz, öffnet sein Heft und beginnt zu schreiben. Außer dem Geräusch seines Stifts auf dem mit Fettflecken übersäten Papier ist nichts zu hören. Dann rülpst jemand, ein Murmeln hier und da und die Kneipe kehrt zur Normalität zurück. Die Wirtin kommt und Pat bestellt ein Bier, dass er herunterstürzt, nachdem er seinen Bericht beendet hat.
Ein paar Wochen später kommt er wieder. Dieselbe Kneipe, dieselbe Zeit, dieselbe Stille. Die Wirtin erkennt den jungen Mann wieder und bemüht sich um Deeskalation. „Ist in Ordnung! Der war schon mal hier“, ruft sie. Alles wieder normal. Aber nicht Pats normal, deren normal. Es schaudert ihn, während er Platz nimmt. „Was soll das heißen?“, fragte er sich. Er öffnet sein Heft, aber er findet keine Worte. Sein Bier kommt, er nimmt einen Schluck, trinkt aber nicht aus. Er geht. Pendeln ist besser als das hier. Er zieht zurück in die Stadt.
Einmal im Moment veranstaltet das Restaurant ein Sportevent für Damen. An sonnigen Tagen auch mit Barbecue.
Ich wurde als Frischfleisch rausgeschickt zu diesen reichen, weißen Frauen. Ich habe den Service gehasst. Da war immer dieser sexuelle, rassistische Unterton, weil ja erwartet wird, dass man bedient. Und das geht einher mit rassistischen Vorstellungen über die Sexualität von schwarzen Männern. Diese Frauen fassten mich einfach an. Ich fühlte mich nicht bedroht, aber eben auch nicht respektiert. Männer sind da aggressiver. Für Frauen und besonders für schwarze Frauen ist es noch schwerer im Restaurant.
Nach 20 Jahren in der Gastronomie, findet er, dass das schlimmste Erlebnis …
Das Allerschlimmste!
… während seiner Ausbildung passiert.
Der Eigentümer ist der Grund, warum ich da weg bin. Er gab mir einen Spitznamen: Black Mamba – als Anspielung auf meinen Schwanz. Weil er und alle anderen glaubten, dass ich etwas mit einer Auszubildenden aus dem Service hatte.
Es hätte schlimmer sein können. Und dann kommt es schlimmer.
Eines Abends vor dem Service stand ich allein an der Schneidemaschine, um das Carpaccio vorzubereiten. Er kommt in die Küche, schleicht sich von hinten an und greift mir zwischen die Beine. Er packt von hinten meinen Schwanz und meine Eier. In manchen Nächten, gegen Ende meiner Ausbildung, bin ich nachts davon aufgewacht. Ich hatte Angst, zur Arbeit zurückzugehen, Angst davor, wie ich reagieren könnte. Ich war es satt, der einzige schwarze Mann zu sein und den ganzen rassistischen Scheiß aushalten zu müssen. Ich war da der erste schwarze Koch und ich denke auch der letzte.
Er sollte nicht der Letzte sein.

Diego
Anfang 2020, beinahe zwei Jahrzehnte nach Pat, beendet Diego seine Kochausbildung im selben Restaurant.
Eigentlich war das ein großartiger Ort, um zu lernen. Aber ich wollte weiter, ich wollte etwas anderes sehen. Ich denke, ein Koch sollte sich auch außerhalb des Fine Dinings ausprobieren.
Allerdings gibt es auch andere Gründe, ein Restaurant zu verlassen, von dem anderen junge Köche nur träumen können:
Gäste
Da waren immer diese älteren, zugeknöpften, reichen weißen Leute. Die interessieren sich einen Scheiß für jemanden wie mich. Ich bin nur der Koch. Deshalb mochte ich nicht für sie arbeiten. Das fühlte sich so an, als wäre ich ihr Diener. Besonders als schwarzer Mann.
Geschäftsführung
Immer wenn wir kolumbianische oder spanische Gäste hatten, musste ich nach draußen kommen. Dann wurde ich vom Eigentümer vorgezeigt. Manchmal fühlte sich das an, als ob ich sein Sklave wäre. „Hier ist mein Kolumbianer!“ Aber so ist das im Fine Dining. Die Leute sind konservativ. Sie verstehen nicht, dass sie mich auch einfach fragen könnten. „Diego kannst du mal nach draußen kommen. Ein paar Freunde sind hier und ich würde dich gerne vorstellen, weil du Spanisch sprichst.“ Aber dieses: „Diego, komm raus!“, als wäre ich sein Sklave. Das ist unerträglich.
Team
Aber es gab auch nette Leute. Ich habe Freunde gefunden. Ich mochte den Restaurantleiter und den neuen Chefkoch. Und sie mochten mich auch. Aber wenn sie mit ihren Frauen und Kinder gefeiert haben, war ich nie eingeladen. Sie können mich mögen, so viel sie wollen, aber sie haben mich nie als einen von ihnen akzeptiert.
Nach seiner Ausbildung findet Diego einen Job in einem Restaurant in der Stadt. Seine neuen Kollegen sind irritiert über seine plötzliche Karriere. Aufgrund seines Aussehens gilt er als der „coole Typ“, als jemand der eine Sonderbehandlung erwartet. Einmal sitzen sie zusammen und plötzlich sagt ein Kollege zu einem anderen: „Du bist jetzt nicht mehr der schönest Mann hier. Wir haben jetzt Diego.“ Alle lachen. Diego kennt diese ausweichende Blicke, die grinsende Münder. Dahinter der Gedanke: „Scheiße, nur weil er schwarz ist.“
Warum sollte jemand wie ich Koch werden, wenn man gemobbt und ausgelacht wird? Ja, ich habe meinen eigenen Stil, ich ziehe mich gut an, ich habe Tattoos. Die Leute sehen mich an und denken, dass ich Schwierigkeiten mache. Wenn ich sie darauf anspreche, sagen sie, dass das nicht so wäre.
Zweifelhaften Komplimente sind ein wiederkehrendes Thema in Diegos gastronomischer Laufbahn. Im ersten Ausbildungsbetrieb sagt jemand zu ihm, dass er so schöne N***-Haare habe.
Das war übergriffig und ich fühlte mich erniedrigt. Aber das war in meinem ersten Ausbildungsjahr, da wollte ich niemanden konfrontieren.
Diego erinnert sich wie seine Mutter, die selbst viel Diskriminierung hinnehmen musste, ihn ermahnt, sich besser zu benehmen, als seine weißen Klassenkameraden.
Wenn damals irgendwas passierte, gingen alle immer automatisch davon aus, dass ich das war.
In solchen Momenten sind alle Augen auf ihn gerichtet.
Ja, ich habe als Kind Mist gebaut. Aber warum? Ich kam nach Deutschland, musste eine neue Sprache lernen und meine Mutter hatte diese beschissenen Putzjobs, während die Eltern der anderen Kinder in der Klasse schöne Berufe hatten. Das macht dich unsicher als Kind. Die anderen Eltern luden meine Mutter nie zum Essen ein. Die Leute sagen: “Wir sind keine Rassisten!”, aber sie behandeln dich nicht wie andere Deutsche.
Ihm fällt es schwer, eine Küche zu betreten in der die einzigen schwarzen oder dunkelhäutigen Menschen die Spüler sind, die lange Stunden arbeiten, wenig verdienen und kaum Perspektiven haben.
Ich sehe meine Familie, ich sehe meine Mutter. Da muss sich etwas ändern. Es sollte nicht normal sein, dass der Schwarze im Raum immer saubermacht.

Pat musste 16.560 km reisen, für seine erste Erfahrung in einer anständigen, respektvollen Küchenumgebung.
In Australien konnte ich mich auf eine normale Behandlung verlassen. Keine Schikane wegen meines Hintergrunds, keine Safari-Witze, keine dummen, provozierenden Fragen. Da habe ich mich schnell dran gewöhnt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, da kennst du diese alltäglichen rassistischen Mikro- und Makroaggressionen – daran gewöhnt man sich nicht. Aber du weißt, wie das ist, man kämpft nicht jeden Kampf. Das ist einfach zu anstrengend. Als ich nach Deutschland zurückkam, hatte ich gesehen, wie die Dinge auch anders sein können, und dachte sofort wieder an Abreise.
Aber dann gibt es diese unerwartete Gelegenheit. Anders als andere deutsche schwarze Köche, anders als etwa Dieuveil Malonga, der eine höhere Wertschätzung seiner Talente in Frankreich und Westafrika vorzieht, ergreift er die Chance und gründet seine eigene Film-Catering-Firma. Eine eher einzigartige Nische in der Gastronomie, in der man wenig mit anderen aus der Branche zu tun hat. Das ist vollkommen in Ordnung für Pat.
Ich kann mit den Wölfen heulen, aber ich möchte nicht mit denen alt werden!
Die Worte kommen tief aus ihm heraus. Es stimmt, die Küche funktioniert nicht ohne Hitze, nicht ohne Opfer, aber bestimmte Leute bekommen mehr Hitze ab als andere. Pat hat diese Hitze überstanden, er hat sich nicht durch die vergiftete Atmosphäre hinter den Vorhängen des Fine Dining-Restaurants brechen lassen. Er macht weiter, nach einem Jahrzehnt im Filmgeschäft liebt er seinen Job noch immer.
Solange ich in Deutschland lebe und arbeite, bleibe ich beim Film. Die Leute sind cool, international, und kulturell sensibel. Es sind Reisende, mit offener Einstellung, jung und alt. Klar, die Leute verwechseln mich mit anderen schwarzen Köchen oder denken, dass ich nicht der Eigentümer wäre. Aber damit kann ich umgehen. Das ist etwas, worüber wir lachen können. Das sehe ich nicht als Mikroagression, eher als eine Art „Mikro-Unwissenheit“. Man kann die Leute leicht eines Besseren belehren. Dann siehst du diesen Funken Erkenntnis, diese kleine Verschiebung in der Perspektive, wenn sie realisieren, dass das mein Gesicht auf dem Logo ist, dass ich der „Food Souldier“ auf dem Wagen bin.
Diego war 10 Jahre alt, als er mit seiner Familie von Cali, Kolumbien nach Münster in Deutschland zog. Ein Kulturschock, wenn auch kein kulinarischer. Bevor er sich mit der kolumbianischen Küche verbunden fühlen konnte, war er schon weg. Sein Interesse galt vor allem Rührei mit Ketchup, seinen Geschmack entwickelte er erst später als Teenager.
Ich war oft bei meiner Oma, meiner deutschen Oma. Die hat immer viel gekocht. Da habe ich die deutsche Küche kennengelernt, darum mag ich sie so gerne. Wenn ich essen gehe, dann am liebsten deutsches Essen. Bier, Schweinebraten, Kartoffelpüree, Sauerkraut, und Rouladen.
Sein Traum ist, Dinge zu machen und zu teilen. Gastronomie scheint da auf der Hand zu liegen, aber er ist sich nicht sicher, auf welches Feld er sich spezialisieren soll. Service kommt nicht in Frage. Bars machen Spaß, sind aber ebenfalls keine Option. Er hat genug von Bars und Clubs für den Rest seines Lebens. Eines Abends laden seine Eltern ihn in ein Restaurant ein. Das Essen kommt, sein Gesicht erhellt sich. Jeder Teller so präzise, so perfekt zusammengestellt.
Da dachte ich: Ich will Koch werden! Ich bin direkt in die Küche und habe nach einem Ausbildungsplatz gefragt. Jetzt arbeite ich einem guten Restaurant mit einer Menge netter und offener Leute. Ich bin zufrieden. Wenn ich mal meinen eigenen Laden aufmachen sollte – manche Leute werden das jetzt als umgekehrten Rassismus bezeichnen – werde ich vor allem schwarze Köche einstellen, Köchinnen, People of Color, LGBTQ+. Wir brauchen solche Umgebungen. Wir brauchen mehr sichere, diverse und fröhliche Orte.
Die englische Originalversion des Essays findet sich auf S. 24-31 der Ausgabe #01.